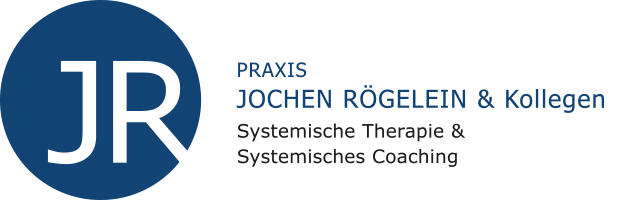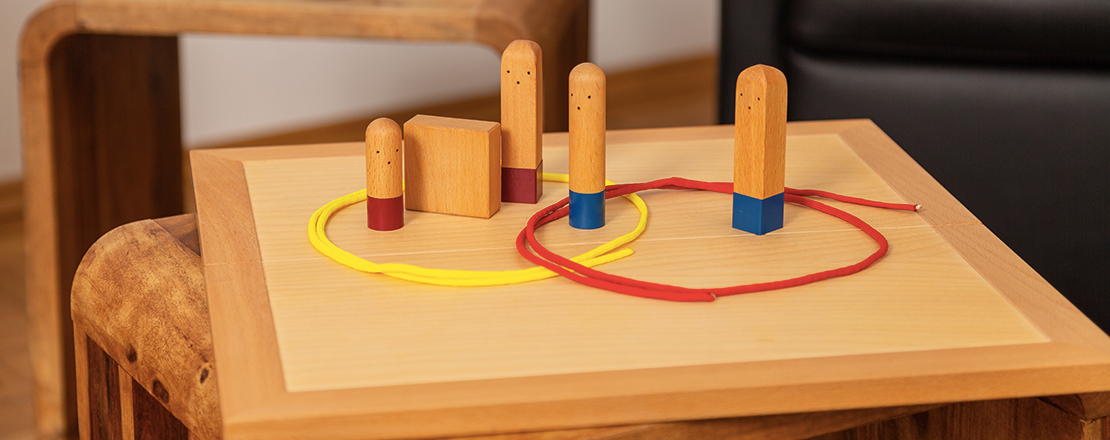Wechselmodell
Betreuungsformen nach einer Trennung
Sehr oft wird angenommen, dass es sich bei dem Begriff „Wechselmodell“ um einen feststehenden handeln würde. In unserer Praxis wird seit vielen Jahren erfolgreich mit verschiedenen individuellen Formen des Wechselmodells gearbeitet.
Zur Begriffsklärung:
Unter dem sehr weit verbreiteten Begriff des Residenzmodells („Umgangsregelung“), das auch häufig gerichtlich angeordnet werden muss, nach dem zuvor sogar die Kinder entscheiden sollten, bei welchem Elternteil sie leben wollen, wird in der Regel festgelegt, dass die Kinder bei einem Elternteil überwiegend leben und betreut werden. Fast ausschließlich leben dabei die Kinder bei den Müttern und sehen ihre Väter üblicherweise alle 14 Tage an Wochenenden. Verbunden wird dann auch mit klaren Unterhaltsregelungen.
Dieses Modell wird zwangsläufig bei hochkonflikthaften Elternpaaren angewendet, die nicht kooperieren wollen oder können oder sollen.
Dies führt u.a. dazu, dass die Vater-Kind-Beziehung stark geschwächt wird und sich viele Väter nicht mehr als Teil dieser Familie begreifen. Sie neigen oft auch aufgrund von Schuldgefühlen zu unangemessenem Verwöhnen der Kinder, wissen zu wenig über deren Entwicklung oder täglichen Strukturen, manchmal geben diese Väter ihre Kinder auch ganz auf, v.a. wenn neue Partnerschaften oder auch Familiengründungen stattfinden. Der Vorteil für Väter besteht darin, dass sie sich relativ uneingeschränkt beruflichen Themen, aber auch neuen Partnerschaften und auch Familiengründungen zuwenden können.
Der Nachteil für die Mütter besteht häufig in der Mehrfachbelastung aus Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und Haushalt. Viele beklagen auch, dass ihnen dieses Modell eine neue Partnerschaft unmöglich mache. Die wirtschaftliche Situation dieser Mütter birgt auch später noch das Risiko von Altersarmut.
Aufgrund dieser Benachteiligungsgefühle kann der Streit über Geld und Umgang mit den Kindern nach einer Trennung noch viele Jahre ausgetragen werden. Bei den Kindern kann dieses Modell zu starken Loyalitätskonflikten, Autoritätsverlusten und Trauer führen, aber auch dem Gefühl, verlassen worden zu sein.
Das Kind kann hier zum Gegenstand des elterlichen Machtkampfes werden.
Aus systemischer Sicht und unter Betrachtung des Kindeswohls im Rahmen der sicheren Bindung ist dieses Modell nur sekundär anzuwenden.
Es gibt aber auch gute Gründe, einem Elternteil das Sorge- und Umgangsrecht zu entziehen, in aller Regel bei Drogenabhängigkeit, Gewalt oder auch schwerwiegenden psychiatrischen Problemen. Dieser Vorgang kann sich an Familiengerichten aufgrund von Gutachterverfahren aber sehr lange hinziehen. Leider entsprechen die Urteile von Familiengerichten nicht immer der Realität und Erfahrungen aus familientherapeutischer Arbeit wird selten heran gezogen zur Urteilsbildung. Auch sind Jugendämter nicht immer die besten Verfahrensbeteiligten. Es gibt bundesweit sehr viele Klagen darüber auch in den Medien.
Aufgrund der offensichtlichen Probleme mit diesem Modell gab es 2018 im Bundestag bereits Beratungen, das Wechselmodell samt Beratung zur gesetzlichen Pflicht für die Eltern werden zu lassen.
Beim Wechselmodell geht es um den grundsätzlichen Wechsel der Betreuung der Kinder durch die Eltern (wie es deren gesetzliche Pflicht ist) in einem individuell zu vereinbarendem Rhythmus.
Die Basis dieses Modells ist eigentlich die Wahrung der sicheren Bindung des Kindes an die Eltern.
Zwei Aspekte müssen dabei unbedingt vermieden werden, die nachhaltige Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern haben können:
Loyalitätskonflikte und die Angst vor dem Verlassen werden.
Kein Kind will verlassen werden oder sich zwischen den Eltern entscheiden müssen! Kinder können und sollen das nicht allein entscheiden vor ihrem 16. Lebensjahr.
Es bedeutet nicht zwingend, dass die Kinder wöchentlich oder gar monatlich mit Gepäck den Wohnort wechseln wie viele denken. Diese Variante wird gern von Eltern gewählt, die nicht kooperieren können oder wollen und sich in einer Art „kaltem Krieg“ miteinander befinden, z.B. weil die Trennung nicht verarbeitet wurde. Für die Kinder ist diese Art von Wechsel aber sehr belastend, häufig fehlt jeder Informationsaustausch der Eltern. Die Kinder werden dann als „Botschafter“ benutzt und in vielen Fällen auch emotional missbraucht.
Eine andere Variante ist das Nestmodell:
hier bleiben die Kinder in der bisherigen Wohnung und die Eltern wechseln sich dort mit der Betreuung der Kinder ab. Nachteil dieses Modells ist die Wohnform der Eltern, denn entweder kommt der ausgezogene Teil immer wieder in die Wohnung des wohnhaften Partners oder es müssen insgesamt drei Wohnungen gefunden und finanziert werden. Das in der Sache sehr gute Nestmodell scheitert meist an der fehlenden Realisierbarkeit.
In unserer Praxis wird daher eine praxisnahe und sehr bewährte Form gewählt:
Wir favorisieren das Konzept der „zwei Zuhauses“ für die Kinder und orientieren uns an den Empfehlungen des deutschen Kinderschutzbundes.
Hier liegen zwei elterliche Wohnungen räumlich nah beieinander, die Wohnungen sind als zwei Zuhauses konzipiert und werden als solche auch konsequent kommuniziert. In Verbindung mit kurzen wechselnden Betreuungsintervallen während der Woche haben die Kinder zeitnah Kontakt mit beiden Eltern, sie müssen sich nicht entscheiden. Die Erwachsenen entwickeln keine Verlustgefühle hinsichtlich der Kinder, Überforderungen oder Benachteiligungsgefühle werden vermieden und sie können beide besser ihren beruflichen Interessen folgen.
Der Nachteil besteht darin, dass keiner einfach wegziehen kann wie beim Residenzmodell, beide Elternteile bleiben voll verantwortlich für ihre Rolle und für die Kinder. Man muss sich dabei klar machen, dass die Erwachsenen die Verantwortung für die Beziehungsgestaltung haben.
Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass dieses Modell in seiner individuellen Entwicklung Zeit sowie auch elterliche Disziplin benötigt. Es wird in gewissen Phasen entwickelt und von uns begleitet. Das Konfliktniveau bleibt erfahrungsgemäß sehr niedrig oder kann schnell aufgelöst werden.
Sog. Scheidungskinder gibt es bei diesem Modell aber nicht.
Dieses Wechselmodell wurde seit vielen Jahren zigfach erfolgreich angewendet und wir verfügen über sehr viel Erfahrung damit. Es besteht aus sechs Bausteinen, die mit den Eltern Schritt für Schritt erarbeitet werden.
Es wird nach Implementierung mit den Eltern mehrfach evaluiert und das Kindeswohl wird fortlaufend überwacht anhand der Entwicklung möglicher Symptome der Kinder, denn Stress drückt sich bei Kindern oft anders aus als bei Erwachsenen.
Therapeuten sind hier auch in der Rolle des „Anwalts der Kinder“.
Die Erfahrung zeigt auch, dass Trennungen auf der Paarebene besser verarbeitet und bewältigt werden können, wenn eine nachhaltig funktionsfähige Form der Elternschaft nach der Trennung entwickelt werden kann. Funktionsfähig heißt, nicht nur die Kinder im Blick zu haben, sondern auch die Erwachsenen.
Dieses Wechselmodell erlaubt den Eltern, ihre Kinder regelmäßig in kurzen Abständen zu betreuen und gleichzeitig auch ihr Privatleben z.B. in neuen Partnerschaften zu leben, ohne dass dies in Konkurrenz zueinander stehen muss.
Kinderfreie Zeiten wechseln sich schnell ab mit Kinderbetreuungszeiten. Die Übergabe der Kinder findet nicht an Haustüren statt, was für Kinder belastend ist, sondern in Schule, Kita oder anderen Betreuungseinrichtungen.
Die Bereitschaft der getrennten Eltern zur angemessenen Kooperation steigt spürbar. Gleichzeitig können die Kinder bei dieser behutsamen Veränderung gut folgen und bleiben ohne Auffälligkeiten.
Eine Trennung ist zwar eine Zumutung, aber mit dieser Methode ist sie zu bewältigen.
Wir bereiten mit Ihnen zusammen dieses Modell individuell, manchmal auch über Monate hinweg, vor und setzen es mit Ihnen zusammen um. Wir erarbeiten mit Ihnen entsprechende Entscheidungshilfen.
Diese intensive Vorbereitung auf ein Modell, das jahrelang funktionieren soll, lohnt sich sehr, weil am Ende Kinder und Erwachsene davon profitieren und eine Familie mit einer neuen Struktur geschaffen wird, die auch in spätere Patchworkkontexte gut integriert werden kann.
Der Kampf ums Kind findet gar nicht erst statt.
In diesem Prozess beraten Anwälte und Steuerberater nur noch die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, Jugendämter und Familiengerichte werden in diesem Prozess erfahrungsgemäß gar nicht benötigt, was Eltern auch sehr stärken kann.
Familie als tragfähiges System muss nicht verloren gehen, wenn eine Trennung auf der Paarebene unumgänglich geworden ist. Familienleben findet nur andere neue Formen.
Unter Praxisinformationen finden Sie weitere Informationen zu den Kosten unserer Praxis für Familientherapie, zur systemischen Ernährungsberatung, Jobcoaching und Paarberatung in München. Erfahren Sie mehr zu unserer Medientätigkeit oder informieren Sie sich weiter unter häufige Fragen und Antworten.